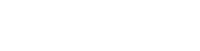Wenn Kinder lernen, verdirbt eine Belohnung ihnen den Spaß. Arbeiten Erwachsene engagiert, kann eine Gehaltserhöhung kontraproduktiv sein. Denn Geld macht aus Spiel Arbeit, aus Leidenschaft Pflicht.
Geld macht aus Spiel Arbeit – die Belohnung sollte daher in der Sache selbst liegen
Die Versuchsleiterin räumt ihren Schreibtisch auf und lässt wie zufällig einen Bleistift fallen. Wie reagieren 20 Monate alte Babys darauf? Heben sie den Stift auf oder lassen sie ihn liegen? Mit diesem Experiment wollte im vergangenen Jahr ein Forschungsteam um den Harvard-Psychologen Felix Warneken überprüfen, wie sich die Hilfsbereitschaft von Kindern beeinflussen lässt. Sie bildeten zwei Gruppen. Die erste bekam fürs Aufheben des Bleistiftes stets einen kleinen Spielklotz geschenkt, die zweite ging jedes Mal leer aus. Das Ergebnis verwunderte. Die Belohnung senkte die Hilfsbereitschaft der Kinder. Sie zerstörte ihren – so glaubt Warneken – natürlichen Altruismus. „Kinder sind per se motiviert zu helfen”, kommentiert der Forscher. „Wer sie für ihre Hilfeleistungen belohnt, der schwächt dadurch ihren inneren Drang, helfen zu wollen”. Ähnliches sagt der Psychologe Edward Deci von der University of Rochester. In einem seiner Experimente belohnte er Kinder etwa fürs Puzzlespielen – also für eine Tätigkeit, die sie von sich aus gern ausführen. Wiederum wirkte die Belohnung destruktiv.
Geld schafft Erbsenzähler
Jene Kinder, die Süßigkeiten fürs Puzzeln bekamen, verloren schneller die Freude daran als Kinder, die gar nicht entlohnt wurden. Mark Lepper schließlich, Psychologe an der Universität Stanford, wies bereits vor Jahren nach, dass sich die Fähigkeit von Kindern, Denksportaufgaben zu lösen, auf eine ganz einfache Weise zerstören lässt: indem man ihnen eine Belohnung verspricht. Forscher wie Warneken, Deci oder Lepper verfechten keine Außenseiterposition. Nach Angaben der Psychologin Nicola Baumann von der Universität Trier belegen mittlerweile mehr als 100 Studien, dass Belohnung die Eigenmotivation schwächt. Und diese Aussage gelte nicht nur fürs Kinderzimmer, sondern auch in den Bürogebäuden und Produktionsstätten erwachsener Menschen, wo man glaubt, dass am ehesten Geld, Urlaub oder Sonderzahlungen die Leistungsbereitschaft steigerten. Das Gegenteil sei der Fall, sagt Lepper. Wer für seine Arbeit bezahlt wird, der folgert unwillkürlich, dass er nicht um der Sache selbst willen arbeitet, sondern nur fürs Geld – und das sei eine fatale Umdeutung. Ein profaner äußerer Anreiz schiebe sich dann über das ursprünglich hehre innere Handlungsmotiv. Plötzlich beginnt der Mensch, den Wert seiner Arbeit zu messen und mit anderen zu vergleichen. Er verwandelt sich zum Erbsenzähler. Warum, fragt er sich, arbeite ich eine Stunde länger als der Kollege und verdiene trotzdem 100 Euro weniger im Monat? Nichts sei idiotischer, als einen Menschen für das zu belohnen, was er ohnehin gerne macht.
Zweifel an Belohnungsplänen
Die Psychologin Teresa Amabile von der Harvard Business School legte in den letzten Jahrzehnten mehrere Studien vor, die den schädlichen Effekt des Geldes dokumentieren. So konnte sie etwa zeigen, dass die kreative Leistung von professionellen Künstlern abnimmt, wenn man ihnen einen lukrativen Buch- oder Plattenvertrag in Aussicht stellt. Gleiches gelte für Kinder. Verspricht man ihnen eine materielle Belohnung, leidet darunter ihre sprachliche Kreativität – ihre poetischen Einfälle werden schlichter und ihre Lust am Wortspiel versiegt.
Freikaufen durch Strafzahlung
Aus diesen Studien lassen sich leicht politisch inkorrekte Fragen ableiten: Wie gut könnten Schriftsteller schreiben, wenn es keine Literaturpreise gäbe? Was für tolle Leistungen wären möglich, wenn keine Gehaltserhöhungen winken würden? Wie viel Freude am Lernen würden jene Kinder entwickeln, denen man kein Geld fürs gute Zeugnis zahlt? Klar ist zumindest, dass auch finanzielle Strafen als Gegenteil der Belohnung nicht wirken. Als klassisch gilt eine Studie, die Wissenschaftler in Israel durchführten. Da viele Eltern ihre Kinder zu spät aus der Kita abholten, wollten die Forscher herausbekommen, ob sich die Pünktlichkeit womöglich verbessert, wenn sie für Verspätungen eine Strafe zahlen müssen. Zur Überraschung aller war das Gegenteil der Fall; noch mehr Eltern kamen später. Mit der Zahlung der Strafe fühlten sich die Eltern wahrscheinlich von der Pflicht befreit, der sozialen Norm zu folgen, die besagt: „Sei pünktlich, lass andere nicht warten”. Sie hatten sich sozusagen freigekauft. Psychologen zufolge belegt auch diese Studie, dass dem Geld ein destruktives Potential innewohnt – ganz gleich, ob es nun als Belohnung oder als Strafe zum Einsatz gelangt. Verhalten lässt sich nicht durch äußere Anreize oder Sanktionen beliebig an- und ausschalten. Und Projekte wie die Online-Enzyklopädie Wikipedia beweisen mittlerweile, dass motivierte Menschen auch für ein „Null-Honorar” ihr Bestes geben.
Belohnungen aufschieben
Mit ihnen ließe sich etwa die Forderung nach einem tief angesetzten Grundeinkommen für alle oder die Praxis der Dauerausbeutung hoch motivierter Arbeitskräfte und Praktikanten rechtfertigen. Diese Zurückhaltung ist vielleicht ein Grund dafür, weshalb in den größten Bereichen der Gesellschaft bislang alles beim Alten geblieben ist. Ob Boni oder Orden, Preise oder Zertifikate – im Berufs- und Wirtschaftleben wimmelt es nur so von Belohnungen aller Art. Und in den Medien wird häufig der Eindruck erzeugt, als erkrankten Menschen an Depressionen, wenn sie nicht unmittelbar für ihr berufliches Tun belohnt würden. Solche Gratifikationskrisen seien schädlich für die Psyche. Das Gegenteil ist wahr. Menschen lernen von Kindesbeinen an, Belohnungen aufzuschieben. Wenn dem nicht so wäre, gäbe es keine Menschen, die sechs Jahre studieren, ehe sie Geld verdienen. Und erst recht gäbe es keine Häuslebauer, die sich 30 Jahre abmühen, um einen Kredit abzuzahlen. Die einfache Regel, wonach ein Mehr an Belohnung automatisch zu einem Mehr an Leistung führt, ist schlicht
falsch. (SZ-online vom 02.09.2009)
Kommentar der Redaktion: Dass sich die Gegenwartszustände unserer Zivilisation in einem extremen Wandel befinden, der Altgewohntes und Traditionelles, auch vielfach Neues, Zeitgemäßes, Notwendiges sowie Besseres in sich trägt, wird zunehmend, teilweise auch gezwungenermaßen verständlich. Ursachen hierfür liegen primär in den evolutiven Prozessen, die das Lebensfeld – Kultur und Zivilisation – zwangsläufig unter Druck setzen, wodurch sich die Gesell schaft über die exoterischen Bereiche der Politik, der Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften den Gegebenheiten anzupassen hat. Jene Volks- oder Staatsgemeinschaft, die diese Anpassung am besten beherrscht, wird viele Vorteile erreichen können. Es ist eine uralte Erkenntnis, dass der Mensch – unabhängig davon, ob „gläubig” oder „nicht-gläubig“, Theist oder Atheist – seine höchsten Leistungen, seine beste Lebenszeit und freudvolles Empfinden dann hat, wenn er in einer außergewöhnlichen Herausforderung er selbst sein kann, er selbst ist! Dies zeigt der moderne Zeitgenosse durch außer – gewöhnliche Leistungen, Anstrengungen und durch den Einsatz, wie sie heute im Bereich der sportlichen Freizeitleistungen erbracht werden. Die Gegenwartsanforderungen bestehen folglich darin, den „Bereich Arbeit” von Seiten der produktiven und sozialen Gestaltung so zu organisieren, dass ein Arbeitnehmer, der eine sinnvolle und sinngebende Tätigkeit sucht, ähnliche Hochgefühle entwickeln kann, wie er sie bei seiner Freizeitbetätigung empfindet bzw. durch Leistung entwickelt. Dies sollte heute im Zeitalter der Automatisierung unverzüglich realisiert werden, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass viele Leistungen von Automaten und Robotern und unglaublich leistungsfähigen Software-Programmen erledigt werden. Hier sind die Unternehmer bzw. ist die Wirtschaft gefordert, in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und der Politik Pilotprojekte in Zusammenarbeit mit Arbeitskandidaten der jüngeren Generation einzurichten. Denn das energetische Leistungspotential, welches jeder Mensch sucht, wurde zwar ideologisch angestrebt, aber offensichtlich – so die zahlreichen Rückmeldungen aus der „Welt der Arbeit” – nie erreicht!
Ob es der Wirtschaft und Politik passt oder nicht: der Trend geht in Richtung einer jedem Menschen von Geburt an zustehenden, lebenslangen Grundversorgung! Daher ist jedem Staatsbürger nach seiner schulisch-beruflichen Ausbildung eine sinngebende Betätigung anzubieten, die ihm nicht nur die Möglichkeit der Weiterbildung und Selbst bestätigung durch Leistung und Arbeit gibt, sondern auch innere Zufriedenheit und Freude, verbunden mit einer geringen, aber angemessenen materiellen Belohnung! Bestimmte Gemeinschafts arbeiten werden heute in den Zivilisationsstaaten schon „ehrenamtlich” geleistet, sofern mit dieser bestimmte Lern- und Leistungsanreize verbunden sind! So sind in Österreich 52% aller Erwachsenen in Vereinen und ähnlichen Organisationen „ehrenamtlich“, d.h. ohne Bezahlung, höchstens gegen Kostenersatz, im Einsatz. In Deutschland und in der Schweiz findet man sicherlich ähnliche Verhältnisse. Es ist an der Zeit, dass Politik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler diesem Leistungs- und selbstlosen Tätigkeitswunsch in Zusammenarbeit entsprechen. Es kann nicht sein, dass allein die Konfessions-Kirchen diese ungeheuren Leistungsreserven im ehrenamtlichen Bereich für sich allein kanalisieren! Sollte das arbeitstechnische Umfeld in Europa nicht dem hier angesprochenen Erkenntnisstand angepasst werden, wird die zunehmende Unzufriedenheit auch zu drastischen – qualitativen wie quantitativen – Leistungsrückgängen führen, nicht zuletzt zu degenerativen Krankheiten seelischer als auch physischer Natur … Die hier zitierten Ausschnitte aus einem Beitrag in der SZ (Süddeutschen Zeitung) weisen deutlich auf diese Umstände hin! Die Schwierigkeit: für dieses Thema qualifizierte Partner von Seiten der Politik und Wirtschaft, aber auch Soziologen und Arbeitspragmatiker zu finden.
N. Westerhoff, Zeitschrift Welt-Spirale 05/2010